 Culture Action Europe (CAE), das Europäische Netzwerk der Kulturinstitute (ENCC), IETM – Internationales Netzwerk für zeitgenössische darstellende Künste und Trans Europe Halles (TEH) haben ein gemeinsames Strategiepapier über die Bedeutung von Kultur und Kunst in nicht-urbanen und peripheren Gebieten in Europa veröffentlicht. Auf der Grundlage langjähriger Erfahrungen werden Herausforderungen für die vielen bestehenden und potenziellen Projekte in diesen Gebieten beschreiben und politische Lösungen zu deren Unterstützung entwickelt.
Culture Action Europe (CAE), das Europäische Netzwerk der Kulturinstitute (ENCC), IETM – Internationales Netzwerk für zeitgenössische darstellende Künste und Trans Europe Halles (TEH) haben ein gemeinsames Strategiepapier über die Bedeutung von Kultur und Kunst in nicht-urbanen und peripheren Gebieten in Europa veröffentlicht. Auf der Grundlage langjähriger Erfahrungen werden Herausforderungen für die vielen bestehenden und potenziellen Projekte in diesen Gebieten beschreiben und politische Lösungen zu deren Unterstützung entwickelt.
Kategorie: CAE
COVID19: Appel europäischer Kulturorganisationen an die Regierungen
 Europäische Kulturorganisationen haben in Stellungnahmen erforderliche Einschränkungen des öffentlichen Lebens zur Eindämmung von Ansteckung durch das Coronavirus unterstützt.
Europäische Kulturorganisationen haben in Stellungnahmen erforderliche Einschränkungen des öffentlichen Lebens zur Eindämmung von Ansteckung durch das Coronavirus unterstützt.
Gleichzeitig unterstützen sie den Aufruf von PEARLE* und anderen NGOs an die Regierungen, Notmaßnahmen für den Kultursektor zur Kompensierung der Folgen zu treffen. Kulturschaffende arbeiten häufig bereits unter prekären Bedingungen und sind nun von einem existenzbedrohenden Einkommensverlust bedroht.
EU 2021-2027: Kulturverbände fordern angemessene Ausstattung für die Kultur
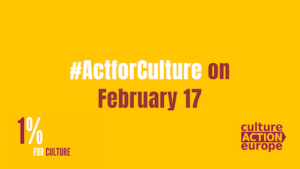 Im Vorfeld der Sondertagung des Europäischen Rates am 20. Februar 2020 und aus Anlass des #ActforCulture Action Day am 17. Februar 2020 haben acht Kulturorganisationen in Deutschland, koordiniert durch den European Music Council, einen Aufruf an Kulturstaatsministerin Grütters, an Bundesfinanzminister Scholz und an Staatsminister Roth vom Auswärtigen Amt gerichtet. Auch das ITI und die IGBK als Mitglieder des Europasekretariats Deutscher Kultur NGOs unterzeichneten den Aufruf. „EU 2021-2027: Kulturverbände fordern angemessene Ausstattung für die Kultur“ weiterlesen
Im Vorfeld der Sondertagung des Europäischen Rates am 20. Februar 2020 und aus Anlass des #ActforCulture Action Day am 17. Februar 2020 haben acht Kulturorganisationen in Deutschland, koordiniert durch den European Music Council, einen Aufruf an Kulturstaatsministerin Grütters, an Bundesfinanzminister Scholz und an Staatsminister Roth vom Auswärtigen Amt gerichtet. Auch das ITI und die IGBK als Mitglieder des Europasekretariats Deutscher Kultur NGOs unterzeichneten den Aufruf. „EU 2021-2027: Kulturverbände fordern angemessene Ausstattung für die Kultur“ weiterlesen
„Culture Crops“-Konferenzbericht veröffentlicht
 Culture Action Europe hat einen umfassenden Bericht über die Konferenz „Culture Crops: Cultural practices in non-urban territories“ veröffentlicht, die Ende Oktober 2019 in Konstanz und Kreuzlingen stattfand. Lesen Sie den Report hier auf der Website von Culture Action Europe (PDF auf Englisch)
Culture Action Europe hat einen umfassenden Bericht über die Konferenz „Culture Crops: Cultural practices in non-urban territories“ veröffentlicht, die Ende Oktober 2019 in Konstanz und Kreuzlingen stattfand. Lesen Sie den Report hier auf der Website von Culture Action Europe (PDF auf Englisch)
170 Teilnehmer*innen aus ganz Europa debattierten über Kulturarbeit im ländlichen Raum und in der so genannten Peripherie: Wo beginnt und wo endet das Ländliche? Wie ist die künstlerische und kulturelle Arbeit in Randgebieten organisiert? Welche Diskrepanz besteht zwischen einer städtischen Vision des Ländlichen und der ländlichen Realität heutzutage?
EU-Förderung für gemeinnützige Kulturprojekte und Netzwerke in Gefahr
 Culture Action Europe fordert die nachhaltige Sicherung der Arbeit des Non-Profit Sektors in der Kultur. In der Erklärung vom 15. November heißt es, dass die Anwendung der neu entwickelten Regeln für die Finanzbewertung in den Förderprogrammen der EU „aktiv verhindert, dass Organisationen im Kultur- und Kreativsektor Zugang zu EU-Mitteln erhalten – insbesondere in bestimmten EU-Ländern, in denen nationale Vorschriften es gemeinnützigen Organisationen nicht erlauben, finanzielle Rücklagen Reserven zu halten, die von der EU als finanziell „stark“ eingestuft werden.“ Ein beträchtlicher Teil der Kooperationsprojekte und europäischen Netzwerke gefährdet sei damit gefährdet.
Culture Action Europe fordert die nachhaltige Sicherung der Arbeit des Non-Profit Sektors in der Kultur. In der Erklärung vom 15. November heißt es, dass die Anwendung der neu entwickelten Regeln für die Finanzbewertung in den Förderprogrammen der EU „aktiv verhindert, dass Organisationen im Kultur- und Kreativsektor Zugang zu EU-Mitteln erhalten – insbesondere in bestimmten EU-Ländern, in denen nationale Vorschriften es gemeinnützigen Organisationen nicht erlauben, finanzielle Rücklagen Reserven zu halten, die von der EU als finanziell „stark“ eingestuft werden.“ Ein beträchtlicher Teil der Kooperationsprojekte und europäischen Netzwerke gefährdet sei damit gefährdet.
Nach der Einführung einer neuen Bewertungsmatrix für die Finanzkraft von Kulturorganisationen im Jahr 2018 wurden in diesem Jahr 27 Organisationen, die für kleine und große Kooperationsprojekte des Programms Creative Europe ausgewählt wurden, als „finanziell schwach“ eingestuft und informiert, dass sie für ihre Projekte keine Vorauszahlung erhalten würden, es sei denn, sie könnten eine Bank- oder Drittmittelgarantie vorlegen.
Der europäische Kultursektor besteht in erster Linie aus gemeinnützigen kleinen und mittleren Unternehmen und leistet einen starken Beitrag zu jeder Priorität der EU-Agenda 2019-2024. Gemeinnützige Kulturorganisationen nehmen eine Schlüsselposition ein bei der nachhaltige Entwicklung einer diversen und inklusiven Europäischen Gesellschaft.
CAE fordert die Einsetzung einer Klausel gemäß der Verordnung Nr. 1288/2013 zur Einführung von Erasmus+, Artikel 19.3 in alle künftigen Programme im Bereich Kultur, Bildung, Innovation, Jugend und Sport: „Neben öffentlichen Einrichtungen und Hochschuleinrichtungen gelten Organisationen in den Bereichen allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport, die in den letzten zwei Jahren mehr als 50 % ihrer jährlichen Einnahmen aus öffentlichen Quellen erhalten haben, als Organisationen, die über die erforderlichen finanziellen, beruflichen und administrativen Kapazitäten verfügen, um Tätigkeiten im Rahmen des Programms durchzuführen“.
Die Bewertung der Finanzkraft für antragstellende Organisationen muss dahingehend überarbeitet werden, dass die EU-Förderprogramme allen Kulturakteuren in Europa zugänglich bleiben.
„Culture Crops – Cultural Practices in Non-Urban Territories“ Culture Action Europe Konferenz
 Vom 23. – 26. Oktober 2019 fand an der deutsch-schweizerischen Grenze in Konstanz und in Kreuzlingen die Culture Action Europe Jahreskonferenz „Culture Crops – Cultural Practices in Non-Urban Territories“ statt. 170 Teilnehmer*innen aus ganz Europa debattierten über Kulturarbeit im ländlichen Raum und in der so genannten Peripherie: Wo beginnt und wo endet das Ländliche? Wie ist die künstlerische und kulturelle Arbeit in Randgebieten organisiert? Welche Diskrepanz besteht zwischen einer städtischen Vision des Ländlichen und der ländlichen Realität heutzutage? Hier finden Sie das umfangreiche Programm der Konferenz (auf Englisch).
Vom 23. – 26. Oktober 2019 fand an der deutsch-schweizerischen Grenze in Konstanz und in Kreuzlingen die Culture Action Europe Jahreskonferenz „Culture Crops – Cultural Practices in Non-Urban Territories“ statt. 170 Teilnehmer*innen aus ganz Europa debattierten über Kulturarbeit im ländlichen Raum und in der so genannten Peripherie: Wo beginnt und wo endet das Ländliche? Wie ist die künstlerische und kulturelle Arbeit in Randgebieten organisiert? Welche Diskrepanz besteht zwischen einer städtischen Vision des Ländlichen und der ländlichen Realität heutzutage? Hier finden Sie das umfangreiche Programm der Konferenz (auf Englisch).
Das ungewöhnliche Format mit gemeinsamen Wanderungen und Fahrten zu Kulturorten in Konstanz und Kreuzlingen und in die Umgebung – so zum Beispiel Kunstraum Kreuzlingen, Stadtbibliothek und Stadttheater Konstanz, Kartause Ittingen, Transitorisches Museum zu Pfyn, Haus zur Glocke u.v.w. – förderte den Austausch unter den Teilnehmer*innen besonders gut. Direkt im Anschluss an die jeweiligen Besuche diskutierten die lokalen Kultur-Gastgeber*innen mit ganz vergleichbaren Projekten aus anderen Regionen Europas ihre Herausforderungen in der täglichen Arbeit, sowie ihre Fragen und Wünsche an die politischen Akteure in der Europäischen Union. In einer „Project-Agora“ präsentierten sich darüber hinaus 26 weitere Projekte aus dem ländlichen Raum Europas.
Dem Abschlusspanel der Konferenz gaben die Teilnehmer*innen aus ihren Gesprächen und Workshops bereits einige Thesen mit:
- Die Stimme des ländlichen Raums sollte auf EU-Ebene mehr gehört werden und vertreten sein. Gleichzeitig braucht es einen stärkeren Austausch des Kultursektors mit dazu bereits existierenden Gremien und Organen, wie zum Beispiel dem Europäischen Ausschuss der Regionen.
- Zwischen EU-Kulturpolitik bzw. den entsprechenden Programmen einerseits und den einzelnen Strängen der EU-Kohäsionspolitik andererseits müssen stärkere Verbindungen geschaffen werden, um neue Querschnittsmaßnahmen zu entwickeln.
- Um nachhaltige Gemeinschaften in nicht-städtischen Gebieten zu fördern und zu unterstützen, sollten kulturelle Praktiken einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen (territorial, kulturell, menschlich, wirtschaftlich), der die Autonomie der Gemeinschaft berücksichtigt, Motivation und Selbstermächtigung fördert, und sich der lokalen Werte vor Ort bewusst ist.
- Dafür muss auch die EU-Kulturpolitik hinsichtlich ihrer Zugangsvoraussetzungen angepasst und breiter aufgestellt werden, wie zum Beispiel bei der Skalierung von Programmen, den Evaluationskriterien, dem Aufbau von Kapazitäten und bei einzelnen Schritten im Antragsprozess. Nur so können die Unterschiede zwischen den verschiedenen Regionen und der Rückstand der am stärksten benachteiligten – meist ländlichen – Gebiete verringert werden und so wird ein wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt gefördert, wie es auch das Ziel der EU-Kohäsionspolitik ist.
- Wir wollen, dass es unter ländlichen Gebieten in Europa einfacher ist, sich auszutauschen, Verbindungen zu suchen, Informationen zu finden und auch kulturelle und kreative Praktiken zu teilen. Dazu gehört das Sammeln von Wissen und Daten, die Erhaltung und Weitergabe von traditionellem Know-how, die Entwicklung von transsektoralen und langfristigen Maßnahmen und die Ermöglichung einer Handlungsfähigkeit bottom-up: von lokal zu global.
Diese Thesen und weitere Konferenzergebnisse werden in den nächsten Wochen in ein Forderungspapier von Culture Action Europe eingearbeitet und zusammen mit der Dokumentation der Konferenz auf der Website von Culture Action Europe veröffentlicht.
